Carmen Maria Machados Memoir "Das Archiv der Träume" erschien 2019 mit der Wucht eines Debüts, obwohl es sich bereits um ihre zweite Veröffentlichung handelte. Bis dahin vor allem für ihre düstere Kurzgeschichtensammlung "Ihr Körper und andere Teilhaber" bekannt, erfand sich Machado mit "Das Archiv der Träume" stilistisch ganz neu, legte weder einen Roman, noch eine sachliche, chronologische Abhandlung über Missbrauch vor, sondern eine eigenartige, strukturell widerspenstige Form: Eine fragmentierte, genresprengende Chronik über häusliche Gewalt in queeren Beziehungen, die sich wie ein Volksmärchen, ein Horrorfilm oder ein Choose-your-own-Adventure-Spiel entfaltet. Machado präsentiert sich nicht nur als Autorin düsterer Geschichten, sondern vor allem als literarische Architektin, die Gefühle in Form übersetzt – insbesondere jene zerklüfteten, verstörenden Gefühle, die Liebe hinterlassen kann.
Was "Das Archiv der Träume" so ruhelos wirken lässt, was ihm seinen Puls verleiht, ist die Art und Weise, in der der Text sich weigert, Narration als bloßes Sammelbecken für Erfahrungen zu nutzen. Seine Struktur ist nicht bloß Gestalt, sondern Diagnose. Machado begreift, dass eine gewalttätige Beziehung keine Abfolge von Ereignissen ist, sondern eine Atmosphäre, eine Zerrüttung der Realität, die sich konventioneller Erzählstrukturen entzieht. Die Leser:innenschaft wird nicht durch eine chronologische Abfolge geführt, sondern durchstreift eine gespenstische Architektur, in der jede zeitliche Ordnung zerfällt. Erinnerungen sind auf sich selbst zurückgeworfen. Die Sprache stottert, wiederholt, widerspricht sich. Es kann keine zuverlässige Erzählinstanz geben, wo ein stabiles Selbst fehlt – es bleiben bloß Fragmente von Beobachtungen, Schuldzuweisungen und Verhandlungen. Das Memoir bedient sich dieser Instabilität als formales Prinzip, stellt eben nicht Klarheit über Verwirrung, Linearität über Entfremdung.
Das Haus in Machados Setzung ist nicht nur eine Metapher für eine Beziehung, sondern die Beziehung selbst. Jedes Kapitel stellt einen Raum dar, einen Korridor, einen wiederkehrenden Traum. Was hinter verschlossenen Türen geschieht, ist subjektiv, flüchtig, gespenstisch gar, weswegen das Memoir formaler Experimente bedarf, um den Erfahrungen, die es einzufangen versucht, gerecht zu werden.
"Das Loslassen gehört zur Liebe dazu", erzählte mir Machado. "Aber im Falle einer missbräuchlichen Beziehung, bestimmen die Bedürfnisse des:der gewalttätigen Partner:in die gesamte Beziehung und die andere Person tritt nicht mehr als Person in Erscheinung. Sie ist nur noch ein Objekt, auf das Einfluss genommen wird."
"Das Archiv der Träume" ist also eine Geistergeschichte: Betroffene müssen die eigene Vergangenheit heimsuchen, um die Deutungshoheit zurückzugewinnen.
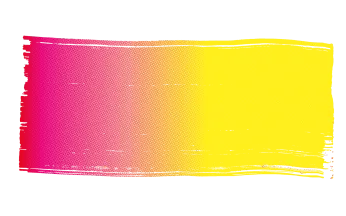
"Liebe verlangt unsere vollständige Unterwerfung, und Machado, sich dessen bewusst, gibt jedes Instrument ihres literarischen Werkzeugkastens in die Hände der Lesenden." P. Eldridge
Machado weist den Gedanken, dass Liebe oder Trauma zwangsläufig Verwundung bedeuten, schnell von sich – zumindest im klischeehaften Sinne. "Trauma fragmentiert das Selbst", sagt sie. "Während Liebe … das Selbst vielleicht nicht zerstört, sondern ein neues Selbst erfindet."
Was sie stattdessen interessiert, ist nicht so sehr das erste Verliebtsein, sondern die Neuausrichtung des Selbst, die Liebe mit sich bringt: Wie sie die Grenzen der liebenden Person verschiebt, ihre Zeitlichkeit und Form verändert. Was sie in "Das Archiv der Träume" auf so unheimliche Weise einfängt, ist die sich verschiebende Subjektivität. Einige Kapitel sind in der zweiten Person geschrieben, die den:die Leser:in in die Position des Missbrauchsopfers versetzt; andere greifen Gattungen wie Märchen, juristische Dokumente oder psychoanalytische Fallstudien auf. Der Überschuss an Formen folgt einer Logik – Liebe verlangt unsere vollständige Unterwerfung, und Machado, sich dessen bewusst, gibt jedes Instrument ihres literarischen Werkzeugkastens in die Hände der Lesenden.
Dennoch neigt Machado nicht zur Sentimentalität. Sie sträubt sich dagegen, im Zusammenhang mit der angeblich erlösenden Kraft der Liebe zitiert zu werden: "Es gibt ein Zitat aus einer meiner Kurzgeschichten, das 'Liebe kann alles überwinden' lautet. Das war ironisch gemeint. Aber trotzdem wird es ernsthaft zitiert und ich frage mich: Habt ihr die Geschichte überhaupt gelesen?" Liebe allein ist für Machado nicht genug. Sie ist Teil einer komplexeren Gleichung, die Freundlichkeit, Respekt und Freiheit umfasst. Die Annahme, dass Liebe immer rein und heilsam sei, ist einer jener kultureller Mythen, den Machado in ihren Arbeiten zu überwinden sucht. Daher zeigt sich das Konzept Liebe in "Das Archiv der Träume" nicht als stete Hingabe, sondern als ein Kontrollmechanismus – der es zu genau nimmt, zu viel verlangt und die Wahrnehmung der Realität seines Gegenübers so sehr verändert, dass diese:r sich selbst kaum wiedererkennt. Zweifellos wohnt Liebe die Kraft zu Veränderung inne – doch ohne Gewähr, dass am Ende jener Veränderung eine Befreiung und nicht vielleicht doch eine Auslöschung übrig bleibt.
Es ist kein Zufall, dass Machado sich der Fiktion bedient, um auszudrücken, was das Format des herkömmlichen Memoirs nicht vermag. Besonders ihr Einsatz von Elementen des Horrors ist keine bloße ästhetische Spielerei, sondern ontologisch zu verstehen. Gewaltgeprägte Beziehungen sind nicht nur schmerzhaft. Sie erschüttern. Sie zersetzen die Realität, so wie Geister es tun. Wer sie erlebt, beginnt, seine eigene Wahrnehmung anzuzweifeln, wird in Loops gefangengehalten.
"Als Kind habe ich mich vor allem gefürchtet", sagt sie. "Trotzdem fühlte ich mich zu Horrorgeschichten und Horrorfilmen hingezogen. Da lag etwas in meinen Angstgefühlen, das sich nach Klarheit angefühlt hat."
"Das Archiv der Träume" überführt diesen kindlichen Schrecken in eine gereifte Erzählarchitektur – das Geisterhaus wird zum Geisterselbst.

"Als Kind habe ich mich vor allem gefürchtet" Carmen Maria Machado
Das Buch zu schreiben war, in Machados Worten, retraumatisierend. "Ich denke, ich bin die Sache nicht besonders klug angegangen", gibt sie zu. "Aber ich konnte nicht aufhören."
Hier ist eine zwanghafte Verletzlichkeit am Werk, ein Sog hin zum Begreifen, selbst wenn dieses Begreifen schmerzhaft ist. Doch für Machado ist nicht Schmerz der Feind. Sondern Gleichgültigkeit. Ihr Memoir macht ein Wegschauen unmöglich – nicht nur das Wegschauen von ihrer eigenen Vergangenheit, sondern vom allgemeinen, gesellschaftlichen Schweigen über Gewalt in queeren Partnerschaften, das seit Generationen herrscht. "Einmal pro Dekade, oder so ähnlich, versuchen wir, darüber zu sprechen", erzählte ihr ein:e Leser:in.
"Ich hoffe, dass es nun an der Zeit ist." Machado teilt diese Hoffnung, allerdings mit einem scharfsichtigen Realismus, der weiß, wie gerne unsere Kultur unangenehme Wahrheiten vergisst.
Der Annahme, das queere Liebe immer utopisch sein soll, steht sie zutiefst skeptisch gegenüber. "Das Archiv der Träume" fordert das bekannte Narrativ heraus, demzufolge Frauen außerhalb patriarchaler Strukturen automatisch gesündere Beziehungen führen. Ihr Buch ist nicht zynisch, sondern verfolgt unerbittlich eine moralische Vision. Die Realität der Gewalt in queeren Beziehungen zu ignorieren, so Machado, sei nicht nur naiv, sondern homophob. Es spricht queeren Personen das volle Spektrum menschlicher Erfahrungen ab, darunter auch die Möglichkeit, zu verletzen oder verletzt zu werden. Das Auslöschen von Geschichten über queere Gewalterfahrungen erzeugt ein grausames Paradoxon: Betroffenen fällt es schwer, ihre Erfahrungen zu benennen, weil die dafür benötigte Sprache ihnen nicht zur Verfügung steht.
Dennoch dokumentiert "Das Archiv der Träume" nicht einfach nur Gewalt: Es ermöglicht eine Architektur, in der diese Geschichten bestehen können. Machado konstruiert einen literarischen Raum, der geräumig genug ist, auch Widersprüche zu beherbergen: Angst und Begehren, Intimität und Entfremdung, Liebe und Gewalt. "Ich war schon queer, bevor ich es selbst wusste", sagt Machado. "Ich dachte einfach, dass alle ihren Freund:innen das Gesicht abknutschen wollten." Das Fehlen einer entsprechenden Sprache verzögert das Verstehen. Das Buch ist in diesem Sinne eine Zeitmaschine – es reist zu einem früheren, sprachlosen Ich zurück, um ihm ein Vokabular anzubieten.
Was "Das Archiv der Träume" davon abhält, in Betroffenheit zu versinken, ist Machados formaler Erfindungsreichtum. Spielen wird zur Überlebensstrategie. Das Buch bedient sich literarischer Mittel fiktionaler Texte: Strukturelle Wiederholungen, metafiktionale Nebenstränge, vielfältige Bezugnahme auf andere Werke. Manche Kapitel sind lediglich einen einzigen Satz lang, andere entspinnen Miniaturessays. Diese Vielfalt schwächt die emotionale Kraft der Erzählung nicht ab, sondern verstärkt sie. Jede neue Form stößt eine neue Selbstwahrnehmung an. Während sich Machado durch ihre Erinnerungen schreibt, legt sie sich nicht auf eine einzelne Erzählstimme fest. Und um genau diese Stimmenvielfalt geht es ihr.
In einer literarischen Kultur, die noch immer von weißen Männern dominiert wird und Erzählungen von Frauen gerne als Bekenntnisliteratur verbuchen und zugleich die literarische Qualität weiblichen Schreibens ignorieren, behauptet sich Machados Arbeit mit hartnäckiger Anmut.
Und doch, trotz aller Fragmentierung, besitzt das Buch die unheimliche Einheit einer Symphonie. Seine disparaten Teile bilden ein Crescendo der Erkenntnis. Mit den letzten Seiten fühlt auch der:die Leser:in, was Machado gefühlt hat: Die Undurchsichtigkeit, das Gaslighting, den verzweifelten Wunsch einer Lüge zu glauben, einzig und allein, weil sie dem Erlebten einen Sinn geben würde. Die Lesenden haben, wie die Erzähler:in, in dem Haus gelebt. Die Architektur hält das aus.
Es liegt eine leise Ironie in dem Umstand, dass Machado, die so häufig als Fantastin bezeichnet wird, vielleicht das klarsichtigste Memoir dieses Jahrzehnts geschrieben hat. Ihr Anspruch an strukturelle Innovation ist nicht Distinktionsbedürfnis, sondern entspricht ihrem Anspruch an Wahrhaftigkeit. Dieser erfordert, dass die Form einer Erzählung die Natur der Erfahrung, die sie vermittelt, widerspiegeln muss. Machado schreibt nicht über, sondern durch Liebe und Trauma und schafft so eine Struktur, die als solche bereits ein Liebesbrief an die Fragmente des Überlebens ist.
Im Gespräch ist Machado gleichermaßen ironisch wie aufrichtig, sie schreckt nicht davor zurück, sich selbst als nervös, ängstlich oder zwanghaft selbstreflektiert zu bezeichnen. Dennoch ist sie eine Autorin mit einer großen Selbstsicherheit, die davon überzeugt ist, dass ihr Leben und die Mittel, mit denen sie es beschreibt, Platz im Bücherregal verdienen. Auch das ist eine Form der Selbstliebe: Nicht die kitschige Affirmation hinter populärer Psychologie, sondern die ernsthafte, gereifte Überzeugung, dass die eigenen Erfahrungen bedeutsam sind. "Ich glaube, in gewisser Weise ist das auch ein Ausdruck dafür, dass ich mich selbst liebe …", fasst Machado zusammen. In einer literarischen Kultur, die noch immer von weißen Männern dominiert wird und Erzählungen von Frauen gerne als Bekenntnisliteratur verbucht und zugleich die literarische Qualität weiblichen Schreibens ignoriert, behauptet sich Machados Arbeit mit hartnäckiger Anmut.
Wenn sie über ihr Schreiben als einen Akt der Rückeroberung spricht, dann wird schnell deutlich, dass sie nicht nur über sich selbst spricht. "Das Archiv der Träume" bietet anderen Betroffenen gewalttätiger Beziehungen eine Schablone für ihre eigenen Geschichten – statt einer Kopiervorlage bietet sie eine Blaupause, die zeigt, wie dehnbar Form sein kann, wenn es darum geht, komplexe Gefühle begreifbar zu machen. Damit reiht sich Machado in eine Tradition von Schriftsteller:innen ein, die Schmerz in Architektur und Architektur in Zeugenschaft verwandeln. Ein Haus, das spukt, ist noch bewohnt. Wenn die Vergangenheit eine Ruine ist, ist sie zugleich Bauplatz für etwas Neues.
"Es ist eine Art revolutionäre Geste", erzählt sie mir, während wir über das Schreiben nicht als Berufung, sondern als universelles Vermächtnis sprechen. "Ich denke, jede:r verdient das", sagt sie in Bezug darauf, das eigene Leben gewissenhaft und en Detail nachzuerzählen. "Es ist ein Ausdruck der Selbstliebe … unerlässlich für unser Überleben."
Diese Annahme liegt ihrem gesamten kreativen Ethos zugrunde: das Geschichtenerzählen ist nicht einigen Auserwählten vorbehalten, sondern eine notwendige Praxis der Selbstwahrnehmung. Ihrer Meinung nach ist das Niederschreiben von Erfahrungen – insbesondere für queere Menschen, für Frauen und für diejenigen, denen lange gesagt wurde, ihr Innenleben sei trivial – nicht nur ein persönlicher Akt, sondern ein politischer. Indem sie auf den Wert ihrer eigenen Erinnerungen besteht, lädt Machado andere implizit dazu ein, es ihr gleichzutun. Ich spüre die leise, aber radikale Großzügigkeit, die in dieser Einladung steckt.
Machado schreibt weiter. Neue Bücher werden erscheinen. Aber bis jetzt bleibt "Das Archiv der Träume" ihr Meisterstück: Ein Buch, dass die Stille nicht nur durchbrochen, sondern geformt hat. Sie hat gezeigt, dass auch queere Liebe gefährlich und ein Memoir verspielt sein kann, dass sich die Wahrheit viele Masken trägt und trotzdem stimmen kann. Am Ende ist sie dem Haus nicht entflohen, sie hat es neu gebaut.
Dieser Essay erschien erstmalig im WORMS MAGAZINE: ISSUE #10, The Love Issue und erscheint hier mit freundlicher Genehmigung der Autorin.
P. Eldridge ist Kuratorin, Autorin und Kulturaktivistin und arbeitet zwischen London und Australien. Sie ist Gründungsredakteurin von SISSY ANARCHY (u.a. 60. Kunstbiennale in Venedig), Kolumnistin für "SISSY" bei Gay Times, Leiterin von Worms World C.I.C. und Mitbegründerin von The Compost Library; Plattformen, die sich unkonventionellen Stimmen, queerem Widerstand und experimentellem Schreiben widmen. Im Jahr 2025 wurde sie als Artist in Residence und Aktivistin beim Amnesty Amplify Summit 2025 von Amnesty International vorgestellt, wo sie gemeinsam an der Verteilung der von SISSY ANARCHY entworfenen "Trans Inclusive Bathroom Access Initiative Stickers" arbeitete und von The Printing Charity mit dem Rising Star Award ausgezeichnet wurde. Ihre Arbeiten erschienen unter anderem in Flash Art, Studio Magazine und CIRCA. Sie hat Künstler*innen und Schriftsteller*innen wie Judy Chicago, Juliana Huxtable, Shon Faye, Cortisa Star, Danielle Brathwaite-Shirley und Torrey Peters interviewt sowie Texte von Chris Kraus, Anne Rower, Estelle Hoy und Octavia Bright herausgegeben. Ihre Arbeit wurde unter anderem in DAZED, Service95, AnOther und in der Tate Modern vorgestellt.


